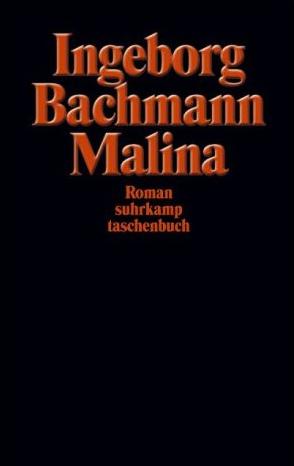
Eine Frau verschwindet in einer Mauer, „Es war Mord“ – aber vom wem und wie? 5 Fragen zum besseren Verständnis.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Berühmt ist Malina vor allem für sein Ende: Die Protagonistin verschwindet in einer Mauer. Wie kommt es dazu? So ganz einfach ist es nicht, den Inhalt von Malina wiederzugeben. Das liegt daran, dass keine gleichmäßig vorwärts fließende Erzählung präsentiert wird, sondern ausschnitthaft Etappen einer Handlung, die aber auch immer wieder unterbrochen werden von Gedanken oder Einschüben die Handlung begleitender Erlebnisse (etwa Interviews). Man nennt das „Montage“. Die Handlung ist dabei eher der Anlass für ein sich immer weiter aufwallendes Gefühls-, Erinnerungs- und Gedankenpanorama der Protagonistin. Die Ich-Erzählerin (und Protagonistin) ist (wohl) eine Schriftstellerin, die unter einer Schreibblockade und anscheinend auch einer labilen Psyche leidet. Sie hat einen Partner, Ivan, einen Banker, und lebt offensichtlich mit einer Figur namens Malina, einem Militärhistoriker, zusammen. Der Roman hat drei Teile: Der erste beschreibt die scheiternde Liebschaft mit Ivan, der zweite Teil eine Reihe albtraumhafter Phantasien über den „Vater“, der die Tochter ermordet und der dritte Teil beschreibt den Versuch, in Dialogen einen Existenzgrund zu finden, was allerdings scheitert, die Ich-Erzählerin verschwindet zum Schluss im Mauerwerk.
Übrigens: Der Roman war ein großer Publikumserfolg und ist heute noch sehr beliebt.
Dafür gibt es viele verschiedene Optionen. „Malina“ bedeutet auf Polnisch „Himbeere“, es kann auch ein Anagramm von „Animal“ sein, eine Variante von „maligna“, der ‚Schlechten‘, aber die Herleitung aus der jüdischen Verbrechersprache, wo „malina“ ein Versteck, vor allem zwischen oder hinter Wänden, bezeichnete, ist am wahrscheinlichsten. Wenn also die Erzählerin am Ende dieses „malina“ wird bzw. in dieses eingeht, weist dies nicht nur auf einen Ich-Entzug hin, sondern auch auf die wahrscheinliche Identität von Ich-Erzählerin und Malina, die sich alleine schon deshalb vermuten lässt, weil Malina immer zuhause ist, wenn die Protagonistin mit ihm sprechen möchte. Auch dass ‚Malina‘ häufiger als Frauen- denn als Männername fungiert, spricht dafür. Malina wäre sodann der männliche Teil der Protagonistin und beide Figuren Teil einer stereotypen Geschlechterdichotomie.
Davon ausgehend stellt sich die Frage, ob mehr als nur diese beiden Figuren identisch sind, die Traumprotokolle und damit die Nähe des Textes zu solchen (in denen eine Person in mehrere Figuren aufgeteilt ist), wären ein Hinweis dafür, aber auch etwa die Buchstabenähnlichkeit von Malina und Ivan. Zu fragen wäre nur, was dadurch gewonnen wäre, beschreibt der Text ein Psychogramm, einen innerer Kampf? Was würde das dann aber für die in ihm geäußerte Gesellschaftskritik bedeuten?
Die Protagonistin weist Ähnlichkeiten mit Ingeborg Bachmann auf, aber hier ist die Biographie der Schriftstellerin eher die Maske einer grundsätzlichen Auseinandersetzung mit Weiblichkeit, Schreiben und dem Patriarchat.
Der Vater steht für den Mann bzw. die Männer und damit wiederum für die patriarchale Gesellschaft. Die ist vor dem Hintergrund des Dritten Reiches und der ungenügenden Aufarbeitung der Kriegsverbrechen (besonders auch in Österreich, der Roman spielt in Wien) zu sehen: Dem Patriarchat wird damit eine gewaltsame, verbietende, tötende Qualität zugesprochen. Diese Verbindung von Vater und Verbot ist nicht eigentümlich für den Feminismus, gerade Texte von Männern haben seit dem 18. Jahrhundert dem Hausvater eine absolute, tyrannische Macht zugesprochen. Insofern geht eine Kritik wie die von Marcel Reich-Ranicki, der den Roman als Ausdruck einer Krankheit Bachmanns verstand, völlig am analytischen Potential des Textes vorbei.
Dieses fügt sich vielmehr in die Frauenbewegung der 60er und 70er (Second Wave of Feminism) ein, die ja gerade nicht nur eine gesetzliche Besserstellung der Frau beabsichtigte, sondern auch auf eine Analyse patriarchaler Machtverhältnisse und kapitalistischer Abhängigkeitsstrukturen abzielte. Hier ist allerdings auf den Umstand hinzuweisen, dass der Roman als zentraler feministischer Text gelesen wird, Bachmann sich aber explizit nicht als Feministin verstand. Dies stellt erstmal kein Problem dar, Autorinnen- und Textaussage müssen nicht übereinstimmen, man kann es aber zu einem Ausgangspunkt der Kritik am Text machen, etwa indem man die stereotypen Geschlechterdarstellungen kritisiert: Männlichkeit wird mit Rationalität, Weiblichkeit mit Emotionalität verbunden. Die männlichen Figuren repräsentieren auch männliche Sphären: die Finanzwelt, das Militär und die Geschichtsschreibung.
Dafür kann man mehrere Antworten finden: Ganz klassisch ließe sich das Problem des Erzählens in der Moderne ins Feld führen, also das fehlende Vertrauen in klassische Formen des Erzählens, aber das ist noch sehr allgemein; Malina verbindet zwei typische Facetten dieser Infragestellung in der Moderne und gibt ihr einen eigene, eben feministische oder zumindest männerkritische, Wendung. Denn es geht um das Erzählen des Ich und dieses wird eben nicht nur aus seinen bewussten Anteilen erzählt, sondern gerade aus seinen Träumen und aus seinen Erinnerungen. Diese sorgen aber nicht für ein geschlossenes, kohärentes Bild des Individuums, sondern führen vielmehr in eine immer größere Auflösung und Infragestellung desselben und dies hat mindestens zwei Gründe: Zum einen die traumatischen Erfahrungen, die Frauen in einer patriarchalen Gesellschaft grundsätzlich machen und nicht nur konkret durch Männer, sondern auch durch die von ihnen etablierten Strukturen und zum anderen durch die Sprache, die eben nicht neutral, sondern ebenfalls männlich, ist.
Hier muss man vielleicht einen kleinen Umweg über die Psychoanalyse machen, die das Problem, das Bachmann hatte, ungefähr zeitgleich erfasste. Jacques Lacan hat in den 1960ern beschrieben, wie der Kontakt mit dem Vater als dem (störenden) Dritten der Dyade Mutter-Kind zur Einführung in die symbolische Ordnung führte, also die Welt der Regeln, Gesetze und damit auch Verbote (der Kontakt mit dem Vater ist ja zunächst einmal nicht natürlich gegeben, sondern erfolgt durch Sprache oder kulturelle Performanz). Sprache ist so gesehen immer väterlich, patriarchal, Lacan nannte es „nom du père“ mit dem Witz, dass „nom“ nicht nur „Name“ bedeutet, sondern auch auf die Wörter „nomos“ (griechisch für „Gesetz“) und „non“ (französisch für „Nein“) anspielt.
Das beschreibt quasi das Dilemma Bachmanns und vieler schreibender Frauen des Feminismus, die versuchten, eine weibliche Schreibweise, eine „écriture feminine“ zu etablieren: Wie schreiben, wenn man beim Schreiben selbst immer Teil von patriarchalen Unterdrückungsstrukturen ist? Wie lässt sich die Sprache daraus befreien? Wie lassen sich Affekte jenseits von Kalkül, Strategie und Abwägung in dieser Sprache beschreiben? Bachmanns experimenteller Stil ist der Versuch, sich damit auseinanderzusetzen und eine Lösung dafür zu finden und der Abbruch des „Todesarten“-Projekts die Einsicht in die Unmöglichkeit der Aufgabe. Auf eine gewisse Weise ist diese Beschreibung von Emotionalität, von Trauma und Depression, auch ein Versuch, eine weibliche Stimme zum Text zu machen, diese ist aber immer versehrt, versucht aber auch permanent gegen die Verwundung anzureden. Vor diesem Hintergrund ließe sich auch behaupten, dass die Auseinandersetzung mit der Sprache und den Möglichkeiten von Beziehungen die eigentliche Handlungsfeder des Romans ist.
Hier ließe sich noch eine grundsätzliche Anmerkung machen, die man häufiger im Zusammenhang mit Literatur von Frauen hört, nämlich dass das Thema „Feminismus“ nebensächlich und ideologisch sei, während Literatur sich doch eigentlich mit dem Abstrakten, dem Wahren, Ästhetischen und Allgemein-Menschlichen, auseinanderzusetzen habe. Das ist natürlich in mehreren Hinsichten völlig falsch: Erstens sind auch andere Texte gerade Gender-Texte, im Bildungsroman-Genre beispielsweise geht es auch ganz dezidiert um die Entwicklungsgeschichten von Männern und eben nicht von allen Menschen. Zweitens geht es dem Text natürlich auch um das Große-Ganze: Gesellschaft, Sprache, Affekte, Beziehungen. Drittens ließe sich noch einwenden, dass selbst die Annahme von Neutralität ihrerseits ideologisch ist.
Bei dem unvollendeten „Todesarten“-Projekt von Bachmann handelt es sich um eine Reihe von Prosatexten, die sich mit „Todesarten“ beschäftigen sollten (etwa auch „Das Buch Franza“/„Der Fall Franza“). Damit sind nicht Techniken wie etwa Erhängen, Erstechen oder Erschießen gemeint, sondern es geht um die Arten, wie Frauen in der patriarchalen Gesellschaft zu Tode kommen. Somit ist auch der symbolische Tod gemeint oder auch ein Selbstmord wäre eine Form des In-den-Tod-Treibens. Deshalb ist der letzte Satz „Es war Mord“ so schillernd, da nicht nur nicht klar ist, wer eigentlich stirbt und wer es getan hat, sondern auch nicht, auf welche Weise. Wenn man dies aber umdreht, hat der Satz eine ‚ausbreitende‘, Wirkung, er umfasst alle und alles und zielt damit auf die ‚tötende‘ Struktur der Gesellschaft.
Der Text wurde zwar als „Roman“ beschrieben, Bachmann wollte ihn aber als „Buch“ verstanden wissen. Tatsächlich löst er die Gattungsgrenzen auf, changiert zwischen Drama, Prosa und Lyrik und sollte als „Ouvertüre“ des Todesarten-Projekts auch Bezüge zur Musik aufweisen. Durch den Titel, der auf das „Versteck“ anspielt und den „Mord“ gegen Ende, gibt es auch Elemente einer Kriminalgeschichte, was auch Bachmann mit ihrem Paratext auf dem Buchumschlag nahelegte. Man kann auch einen Liebesroman darin sehen. Die letzten beiden Gattungszuschreibungen laufen Gefahr, die Handlung zu bagatellisieren, sie können aber auch als Versuch verstanden werden, über ‚populäre‘ Genres eine Annäherung an ein Thema jenseits des (männlichen) Höhenkamms zu unternehmen.
