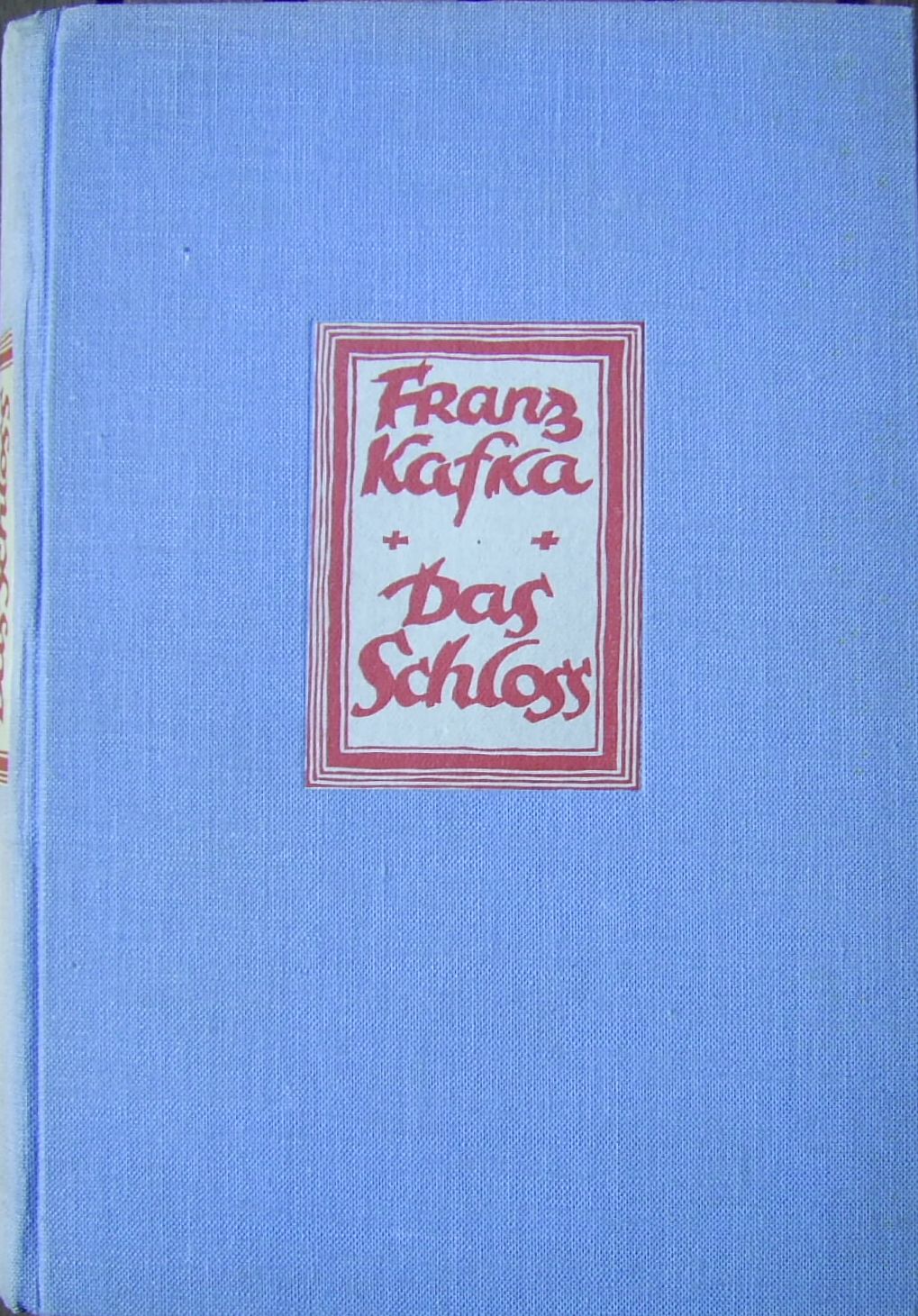
Wieso kommt K. nie beim Schloss an? Diese und weitere Fragen beantworten wir hier.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Ich habe gemerkt, dass eine Inhaltsangabe letztlich überflüssig ist, weil man diese überall finden kann, deshalb eine kurze Einschätzung. Es ist schwer zu sagen, welcher Kafka-Roman der Beste ist, aber es ist klar, dass sie zu den besten Romanen der deutschsprachigen Literatur gehören, wahrscheinlich der Weltliteratur. Während einige den Proceß mehr schätzen, weil hier Kafka die Problematik von Individuum und Gesetz bzw. Macht und das ‚Kafkaeske‘ besonders eindrücklich vor Augen führt, bevorzugen andere das Schloß, weil das Thema zwar auch hier vorkommt, aber der Text sich mit noch viel mehr beschäftigt, etwa auch die Themen Arbeit und Erotik stärker einbezieht. Gewissermaßen kann das Schloß als Summe des vorherigen Schreibens Kafkas verstanden werden und man kann einige Motive im Roman wiederfinden, die man aus anderen, kürzeren Texten Kafkas kennt. Somit kann der Roman zum Spätwerk Kafkas gezählt werden und ist stilistisch extrem ausgereift. Was man aber auch noch erwähnen sollte, ist der Humor des Romans, es gibt so viele komische Wendungen und absurde Situationen, dass man ihnen als einen der wenigen wirklich guten komischen Romane der deutschen Literatur auffassen kann.
Das wird nicht klar. Es wird etwa nie klar, ob die Chiffre „K“ einen Vor- oder einen Nachnamen bezeichnet. Ks kommen ja auch in anderen Texten Kafkas vor, etwa als Josef K. im Proceß. Deshalb lag immer nahe, K als Stand-In für Kafka zu verstehen. Immerhin kommen ja auch die Impulse für den Roman aus Kafkas Leben, die Idee zum „Schloß“ hatte er bei einem Sanatoriumsaufenthalt in Spindlermühle, in dessen Nähe das Schloß Friedland liegt.
Viel spannender ist jedoch die Frage, ob K wirklich der Landvermesser ist oder nicht. Der Satz „Das Schloß hatte ihn also zum Landvermesser ernannt“, erweckt den Eindruck, als ob er es davor nicht gewesen wäre. Und tatsächlich: Man kann das Anfangsgeschehen auch so begreifen, dass K ein Wanderer oder Hausierer ist, der sich in der Gaststube niederlässt und sich den Beruf Landvermesser spontan ausdenkt, um weiterschlafen zu können. Auch erst nach dieser überraschenden Bestätigung sieht K „oben deutlich umrissen das Schloß in der klaren Luft“. Sein Bleiben vor Ort wäre dann gar nicht geplant, sondern vielmehr ebenfalls improvisiert und er versucht sich in die Rolle, die ihm gegeben wird, einzuleben. Dabei kommen ihm zahlreiche Aufgabe zu, nur Land vermisst K keines. Wieso er aber eigentlich genau zum Schloss will, bleibt ebenfalls unklar; womöglich, um eine endgültige Bestätigung über seinen Status zu erhalten, aber wieso sich des Risikos aussetzen, nicht als Landvermesser anerkannt zu werden?
Es gibt eine sehr komplizierte Bürokratie, die extrem undurchsichtig ist und für absurd-komische Effekte sorgt, etwa bei der Aktenverteilung. Die Komplexität zeigt sich schon in den Namen, etwa „Sortini“ und „Sordini“. Auch der Name „Klamm“ erzeugt mehrere Assoziationen, die von „feucht“, „klein“, „unheimlich“ über „gebrochen“ im Tschechichen gehen. Hinzuweisen wäre hier darauf, dass Klamm mit K anfängt und 5 Buchstaben hat – wie Kafka. Und eventuell ist Klamm eine Spiegelfigur zu K und der Weg ins Schloss nur ein Weg zu seinem eigenen Ideal zu kommen … unten dazu mehr.
Die Frage wirft aber noch eine andere auf, nämlich: Was gehört eigentlich zum Schloss und wo wird nicht dafür gearbeitet? Denn das Dorf gehört ja irgendwie doch zum Schloss, es ist durch seine Inklusion exkludiert. Der absolute Machtanspruch bereich der Schlossangestellten gilt auch unten wie etwa die Geschichte der Familie von Barnabas zeigt, die dafür sanktioniert wird, dass seine Schwester Amalia ein oszönes Angebot Sortinis ablehnt. Auch dass Gespräche mit offiziellem Charakter zufällig stattfinden, weil man bei jemandem ins Zimmer läuft und sich dann auch noch dabei vertut (K geht zu Bürgel statt Erlanger), zeigt die Allgegenwart des Schlosses, aber auch, dass sich Offizielles und Inoffizielles permanent vermischen und nie in reiner Form auftauchen.
Dies, und das heftige Regime, das das Schloss sich selbst und allen unterwirft, sorgt zur völligen Erschöpfung aller Beteiligten; eigentlich sollte K nach Kafkas Plänen am siebten Tag vor Erschöpfung sterben. Diese permanente Müdigkeit und Überarbeitung stammt nicht nur aus Kafkas eigenem Leben, der neben einer vollen Stelle ja nachts an seinen Texten schrieb, sondern kann auch als eine Analyse des modernen Arbeitslebens verstanden werden, das durch Beanspruchung des ganzen Menschen und den permanenten Versuch, Grenzen zu überschreiten, zur Erschöpfung desselben beiträgt. Ja, tatsächlich kann man für die Zeit der Weimarer Republik eine Kultur der Erschöpfung konstatieren, die sich sowohl im Arbeitsleben wie im Militär, in der Politik und im Nachtleben zeigte.
Die Nicht-Grenze zwischen Schloss und Dorf und Bürokratie und Leben zeigt auch, dass die Bürokratie immer schon da war, weil man in bürokratische Zusammenhänge hineingeboren ist und das Leben und Sterben als beglaubigte Tatsachen von erfolgreichen bürokratischen Prozessen abhängen (Ausstellen der Geburts- und Sterbeurkunde), dass die Bürokratie sich aber immer versucht zu entziehen, wenn man ihrer habhaft werden will, sie ist eben immer auch noch nicht da und man wartet darauf, dass sie sich einem endlich zeigt.
Dafür gibt es mehrere Gründe:
Zum einen kommt dem Schloss ja eine schon fast mythische Dimension zu und es greift auf bekannte Überlieferungen aus Mythen und Märchen zurück. Insofern könnte man behaupten, hier solle etwa Grundsätzliches gezeigt werden, etwa die Ausbeutung der Dorfbewohner bzw. Bauern durch eine Verwaltung mit herrschaftlicher Macht. In dieser Welt gehören ja anscheinend sexuelle Übergriffe zum Usus und werden nicht geahndet, vielmehr ist eine Verweigerung schädlich, wie die Geschichte Amalias zeigt und auch Friedas Position als Geliebte Klamms schenkt ihr eine Aura der Macht.
Kafkas Bildsprache zeigt Nähe zum expressionistischen Film, Kafka war ja ein begeisterter Kinogänger und viele seiner Texte scheinen davon beeinflusst zu sein. Und auch dort gibt es auch häufiger Schlösser, in denen pathologische Täter und Verrückte sitzen (etwa bei Nosferatu, 1922). Von dem Schloss scheint auch eine zugleich bedrohliche wie hypnotische Kraft auszugehen, die ja auch K befallen zu haben scheint.
Auf eine ebenfalls kulturell präformierte Konstellation, nämlich die von männlichem und weiblichem Geschlecht, scheint die Topographie zu verweisen. Sie scheint auf einer Hierarchie von übergeordnetem männlichen rationalen phallischen Schloss und niedergestellter weiblicher körperlicher undefiniertem Dorf zu verweisen. Und auch wenn diese Opposition häufig nahegelegt wird, wird sie permanent unterlaufen, etwa durch das Mädchengeschrei des Sekretärs Bürgel oder die Überblendung von Schloss- und Dorfbezirk.
Man könnte auch in Abwandlung dieser Überlegung behaupten, hier zeige sich ein Instanzmodell der Psyche mit Schloss-Über-Ich und Dorf-Es, wobei K als Ich seinen Weg darin finden muss. Zugleich verweist es aber auch auf die Weiterentwicklung dieser psychoanalytischen Theorie, wenn gerade die Verschränkung der beiden Bereiche, die Es-Anteile des Über-Ichs und sein genießender, lustvoll-sadistischer Charakter gezeigt wird. In dieser Konstellation verfehlt sich das Ich immer und braucht ein Begehren, das nie zur Vollendung gelangt. Diese Dramaturgie scheint dem Roman auch eingeschrieben zu sein.
Man könnte dann auch die psychonalytischen Instanzen von Imaginärem und Symbolischen hierauf anwenden und sagen, dass das Schloss das Idealbild, die Imagination darstellt, die nie zu erreichen ist (Klamm als Wunschbild K’s) und sich im Dorf unten der Kampf um das Symbolische zeigt, die Mühseligkeit, sich in einer Welt der Zeichen zurechtzufinden, diese richtig zu benutzen und zu interpretieren. Deshalb gibt es dort auch immer Schnee Dieser macht nicht nur innerhalb der Handlung alles mühsam, sondern man kann (eher sollte) ihn sich auch als weiße Fläche, als Blatt, vorstellen, in das sich K einschreibt, auf dem er Spuren hinterlässt, die aber bald auch wieder zugeweht werden. Kafkas Schreibdynmaik ist legendär, er kämpfte immer wieder mit seinen Texten, vor allem den Anfängen und Enden, gerade auch im Schloß. Es geht also im Schloß auch um eine Allegorie des Schreibens. Der Weg des Protagonisten zum Schloss ist der Weg eines Zeichens zu seiner Vollendung und beides bleibt fragmentarisch.
Es war nie vorgesehen, dass K ankommt, zumindest erwähnte Kafka Brod gegenüber, dass K sterben solle, ohne im Schloss anzukommen, allerdings hätte er einen Teilerfolg errungen und eine permanente Aufenthaltserlaubnis erhalten. Vor dem Hintergrund der oben erwähnten Deutungsaspekte scheint dies auch nur schlüssig, weil hier Mechanismen beschrieben werden, die gerade keine Auflösung oder Vollendung zulassen: Weder auf der Ebene des Begehrens noch der Überwindung der Geschlechterunordnung noch der politischen Ausbeutungsverhältnisse noch der des Schreibens. Dies liegt eben auch an der Grundanlage des Romans, dass das Dorf zum Schloss gehört und zugleich außer ihm steht.
Und wenn man sich die Handlungsdynamik vor Aufgen führt und dass jede Tat Myriaden Neuauslegungen zulässt, kann man sich durchaus vorstellen, wie der Roman ins Unendliche wächst.
