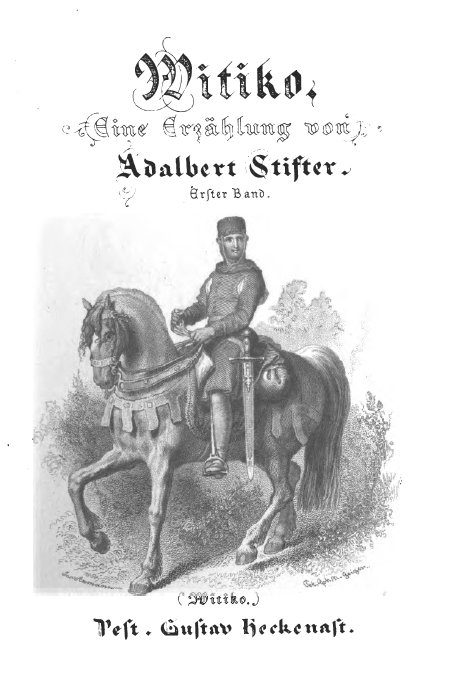
Ein sehr langer Roman über eine kaum bekannte Figur des Hochmittelalters — 5 Fragen gegen die Berührungsängste.
Dies kann man in einem spezifischen und einem allgemeinen Rahmen verstehen. Zunächst zum Allgemeinen: Im 19. Jahrhundert wird, auch aufgrund des Historismus, das Archiv als Ausgangspunkt der literarischen Inspiration besonders wichtig. Hier spielt die Abwendung vom Geniegedanken und die Zuwendung zur Realität hinein, aber auch der Druck durch Vorbilder, von denen man sich durch eine neue Wahl von Stoffen abgrenzen wollte. Es ist nicht so wie bei Schiller, der zwar viel recherchierte, aber die Handlung auch sehr frei gestaltete, um sie seinen Idealen anzupassen, der Stoff gibt die Geschichte quasi vor. Michel Foucault bezeichnete diesen Wandel im Zusammenhang mit Gustave Flaubert so, dass man hier das „Imaginäre [als] ein Phänomen der Bibliothek“ verstehen müsse, es „haus[e] zwischen dem Buch und der Lampe“.
Der spezifische Rahmen schließt sich daran an, Stifter selbst hebt die Arbeit am Text und das intensive Quellenstudium hervor, um am „Körper des Mittelalters“ zu feilen. Dabei benutzte er vor allem zeitgenössische Geschichtsschreibung und mittelalterliche Dichtung, also wenig mittelalterliche Historiographie. Er versuchte also schon, sehr genau die dargestellte Epoche wiederzugeben, bediente sich dabei aber auch eines fiktionalen Anteils. Nun ist aber der entscheidende Punkt, dass sich bei ihm die Geschichte gleichsam von selbst schreiben soll. Immer wieder revidiert er seinen Text, um einen ganz neutralen Stil ohne Bewertungen zu kreieren. Der Text redet aus seinen Dokumenten heraus und es obliegt den Leser:innen, die Handlung einzuordnen, zu bewerten und überhaupt erst zu verstehen.
Auffällig an dem Roman ist die stete, fast schon litaneiartige Wiederholung von Sätzen, die wörtliche Nacherzählung von Berichten und Begebenheiten, die identische Wiederholung von Passagen. Das hat mehrere Effekte: Zum ersten signalisiert es Genauigkeit, ein lückenloses Dokumentieren, wenn das eigentlich Redundante wiederholt wird. Durch diese Wiederholung erhält das Gesagte aber eine Bedeutungsaufwertung. Dies betrifft einerseits die Darstellung der mittelalterlichen Hofgesellschaft und der Hofformalitäten und der Ritualisierungen. Es stellt das politische Agieren und den politischen Raum aus. Es ist aus politischer Sicht wichtig, dass jede Partei die Gelegenheit erhält, alles zu sagen, was sie will, sich dabei aber auch an Regeln hält, bei denen nicht alle gleich viel sagen dürfen. Jede Aussage bietet dadurch aber die Möglichkeit zur Distinktion, also der Unterscheidung durch Details in der Nacherzählung, durch Bewertungen und strategisches Handeln, das sich darin ausdrückt. Man sieht dies beispielsweise auch an der Kleidung, die hervorgehoben wird und wo jede Hutfeder ein Abgrenzungszeichen darstellt. In dieser Klammer von Aussagewiederholung und -variation erzeugt der Text aber genau eine Multiperspektivität und ein neutrales Erzählen, das die Geschichte zum Sprechen bringt.
