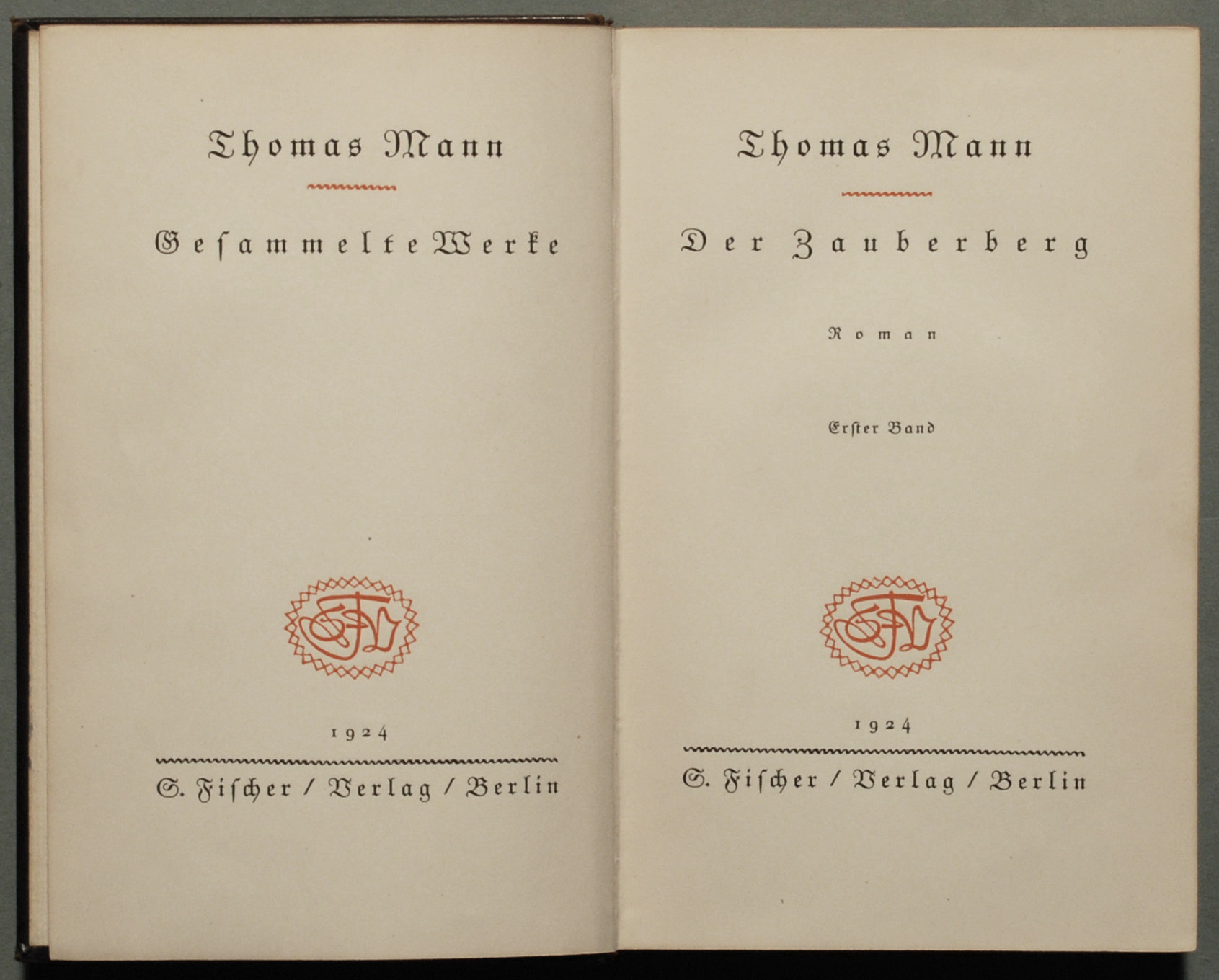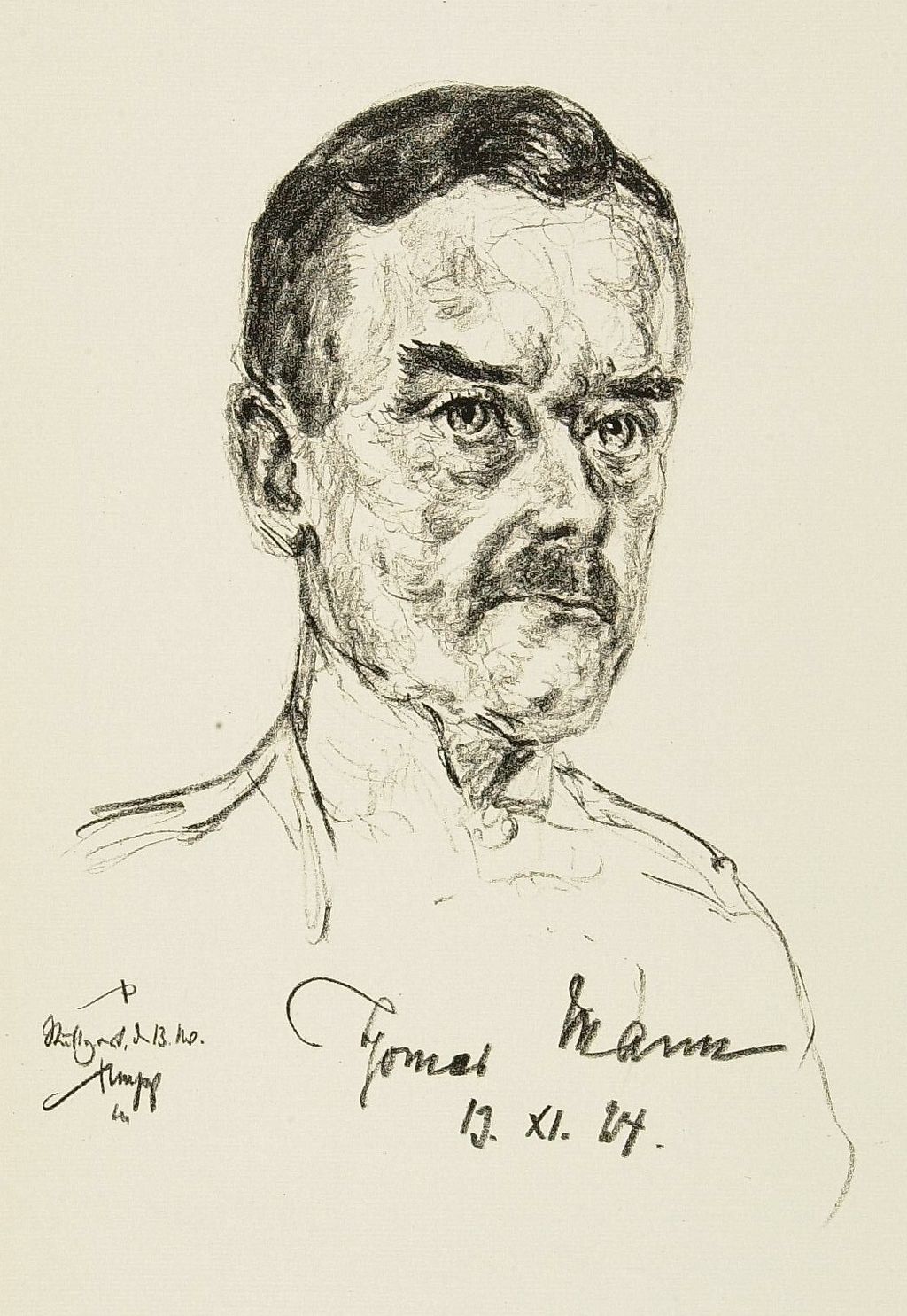
Ich und die anderen. In Thomas Manns Jahrhundertroman stellt Fragen nach dem Einzelnen, der Gesellschaft und dem Leben.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Dieser Text entsteht, weil sich im November das Erscheinen des Zauberbergs zum 100. Mal jährt. Außerdem gibt es nur wenige Texte, mit denen ich mich so intensiv auseinandergesetzt habe. Der Zauberberg nimmt eine außergewöhnliche Rolle im Œuvre Thomas Manns ein. Er gilt vielen als sein bester Roman und ist neben den Buddenbrooks, Doktor Faustus sowie den Erzählungen Tonio Kröger, Der Tod in Venedig und Mario und der Zauberer sein bekanntester Text. Während einigen die Buddenbrooks noch zu sehr im Realismus des 19. Jahrhunderts verankert sind und der Doktor Faustus zu stark in die Avantgarde der Moderne hineingreift, findet sich im Zauberberg ein Mittelweg. Allerdings ist dies nicht der Grund für die Beliebtheit des Romans, es sind vor allem die Figuren und die sehr plastische Darstellungsweise Manns.
Die Geschichte ist schnell erzählt: Ein 23-jähriger Mann kommt nach seiner Ausbildung zu Besuch bei seinem kranken Vetter in einem Sanatorium in Davos. Anstatt nur drei Wochen dort zu bleiben, bleibt er für sieben Jahre und geht erst wieder, als der Erste Weltkrieg ausbricht. In dieser relativ geschlossenen Welt des Sanatoriumsbetriebes trifft er auf allerlei skurrile und interessante Gestalten, die ihn einerseits vor Herausforderungen stellen und damit zu einem Reifeprozess beitragen und andererseits mit den Diskussionen der Zeit um 1900 und deren technologischen Neuerungen bekannt macht.
Auf einer neutralen Ebene lässt sich der Zauberberg als Sanatoriumsroman vor dem Ersten Weltkrieg einordnen. Das Phänomen des Sanatoriums war in der Zeit um 1900 weit verbreitet und fand auch literarisch Niederschlag – man denke etwa an Franziska zu Reventlows Der Geldkomplex (1916) oder Knut Hamsuns Das letzte Kapitel (1923); erst kürzlich erschien Heilung von Timon Karl Kaleyta, der das Motiv aufgreift. Diese Sanatorien waren bei der europäischen Oberschicht sehr beliebt. Zugleich ist es ein Gesellschaftsroman, der das Zeitalter der Dekadenz bzw. der Moderne zu erfassen versucht. Da dies über eine Reflektorfigur geschieht, deren Perspektive eingenommen wird, steht diese im Zentrum. Allerdings entwickelt sich der Text nicht als Schelmenroman wie Felix Krull, sondern als Entwicklungs- oder Bildungsroman – darüber gibt es eine Diskussion, auf die weiter unten eingegangen wird.
Die Entstehungsgeschichte des Romans ist berühmt und prägend. Um 1900 war die Tuberkulose eine weit verbreitete Krankheit, die vor allem junge Menschen betraf. 1912 reiste Thomas Mann mit seiner Frau Katia, die Ende 20 war und unter Lungenproblemen litt, nach Davos – ein Ort, der sich als internationaler Kurort etabliert hatte. Mann blieb drei Wochen, wobei ihm vom Arzt „profitlich“ unterstellt wurde, er sei krank und müsse länger bleiben. Später, als der Zauberberg bereits weit gediehen war, besuchte er Davos nochmals alleine.
Der Roman hat zwei inhaltliche Schwerpunkte und dadurch eine Form, die manchmal eher als vernebelt oder „wolkig“ aufgefasst wurde, was aber auch zum Erfolg des Romans beitrug. Einerseits entwickelte er sich aus der persönlichen Erfahrung mit Katia und als Auseinandersetzung mit bzw. Parodie auf den Tod in Venedig, wobei der Tod diesmal nicht von tragisch-pathetischer, sondern von humorvoll-grotesker Seite aus beleuchtet wird. Andererseits wurde der Roman mit Beginn des Ersten Weltkriegs zum Abgesang auf eine europäische Vorkriegsepoche. Er griff teilweise Thomas Manns politische rechtskonservative Ansichten aus den „Betrachtungen eines Unpolitischen“ auf, wurde zugleich aber auch Zeugnis seiner republikanischen Wende.
Der Roman wurde also gewissermaßen einmal von vorne und einmal von hinten geschrieben. Was diese Elemente verbindet, ist das Thema des Verfalls und der Dekadenz, das für die Zeit um 1900 typisch war. Tatsächlich erschien der Roman in zwei Teilen, und man kann auch von einer inhaltlichen Zweiteilung sprechen, die mit der Abreise Clawdia Chauchats stattfindet. Dadurch verschiebt sich die Perspektive von einer persönlich-immanenten Ebene, bei der es auch um Erotik geht, zu einer transzendenten, die die politischen Geschehnisse der Zeit reflektiert.
Doch natürlich ist der Roman nicht nur aus persönlichen Erfahrungen und historischen Einflüssen entstanden, sondern greift zahlreiche Intertexte auf. Prägend ist wie immer Nietzsche und seine Überlegungen zur europäischen Dekadenz – von ihm stammt auch das Wort „Zauberberg“. Das Wort findet sich aber auch in der Romantik wieder, und die Texte der Romantiker Tieck und Novalis sind ebenfalls entscheidend, weil das Sanatorium und der Berg, auf dem es steht, mit dem Hörselberg (dem Venusberg) verbunden wird – in der Romantik der Ort, an dem noch zur Erotik gefunden wird, aber auch eine höhere Erfahrung möglich ist.
Zugleich gibt es Anspielungen auf die Odyssee, wo der Weg auf den Berg hinauf für den Weg in die Unterwelt steht. Äußerst wichtig ist als Referenzpunkt Faust, sowohl in seiner Zweiteilung als auch in gewissen Personal-Dubletten (Chauchat als Gretchen, Ziemßen als Valentin), was sich teilweise in direkten Zitaten niederschlägt. Darüber hinaus bedient sich Mann noch zahlreicher anderer Intertexte, vor allem aus dem Bildungsroman, etwa bei Goethe (Wilhelm Meisters Lehrjahre) und Keller (Der Grüne Heinrich).
Das Wort „Zauberberg“ ruft etwas Geheimnisvoll-Mystisches auf, hat aber zugleich etwas Spöttisch-Holperndes, und diese Dopplung scheint sehr prägend für den Roman zu sein.
Auf dem Zauberberg wird Castorp vom Tod fasziniert. Doch dieser Tod hat mehrere Dimensionen: einerseits eine transzendente, überzeitliche, sinnstiftende Ebene und andererseits eine immanente, abjekte, materielle Ebene – und dies spiegelt sich im Titel wider.
Wie bereits erwähnt kann der Roman grob als Sanatoriums-, Gesellschafts- und Bildungsroman gelesen werden. Es gibt aber noch viele andere Zuschreibungen, und diese hängen alle von der Einschätzung der Krankheit ab. Ob Castorp nun krank ist oder nicht, wird nie geklärt – er könnte es sein, er könnte es aber auch nicht sein. Entscheidend scheint vielmehr zu sein, dass er vor Ort bleiben möchte und die unklare Befundlage zu seinen Gunsten zu nutzen weiß.
Warum ist dies überhaupt interessant? Die Krankheit selbst ist nicht einfach nur ein Phänomen, das einen menschlichen Körper befällt, sondern schon von jeher, und bei Mann besonders, eine Metapher, die für verschiedene Bedeutungen steht und sich auf verschiedenen Ebenen ausdeuten lässt. Je nachdem, wie man sie sieht, ist der Schwerpunkt des Romans ein anderer:
- Die Krankheit lässt sich als Zeichen von Verfall oder Dekadenz lesen, die eine europäische Elite am Vorabend des Ersten Weltkriegs befallen hat. Fast alle Figuren dort sind krank: sei es der Arzt Behrens, die Russin Clawdia Chauchat, der Kolonialhändler Peeperkorn, der Jesuit Naphta oder der Enzyklopädist Settembrini. Das betrifft sowohl den Soldaten Ziemßen als auch den Psychoanalytiker Krokowski und den Ingenieur Castorp – alles Sozialfiguren der Zeit um 1900.
- Die Krankheit steht auch für den Tod und die Faszination mit dem Tod. Castorp wird im Sanatorium in eine ihm unbekannte Welt eingeführt, die ihn fasziniert. Doch diese Welt ist vom Tod durchströmt – andauernd sterben Menschen, aber es bleibt witzig. Castorp gibt sich also einerseits einer liederlichen Seite in sich hin, die nicht arbeiten will und nur die müßige Freude sucht, andererseits versucht er auch, etwas über grundlegende anthropologische Zusammenhänge zu lernen.
- Dieses Lernen tritt in vielerlei Hinsicht zutage, vor allem aufgrund seiner Erfahrungen und seiner zahlreichen Gespräche mit Mentoren und Methodenfiguren. Deshalb wurde der Roman häufig als Bildungsroman in der Tradition der deutschen Bildungsromane verstanden. Allerdings ist in diesem Roman keine Synthese zu finden – es gibt sie hier einmal kurz im Kapitel „Schnee“, doch sie bleibt nur temporär. Die Auseinandersetzung mit enzyklopädischem Wissen ist in der Anlage auf keine Zusammenführung ausgelegt, sie zeigt vielmehr, dass diese Synthese gar nicht mehr möglich ist.
- Die Auseinandersetzung mit dem Tod in seiner immanenten Gestalt ist auch eine Faszination mit dem Abjekten, dem Ekelhaften und der puren Körperlichkeit. Der Körper wird extrem hervorgehoben in diesem Roman, dem zugleich kraft der Kulturgeschichte eine feminine Seite zugeschrieben wird.
- Damit geht auch einher, dass die Krankheit eine Erhitzung ist, und diese Hitze bedeutet, dass die Leute „hot“ sind. Die Krankheit steht also auch für Erotik. Dies ist im Fall von Castorp noch einmal besonders interessant, weil bei ihm diese Geschichte als eine Re-Homosexualisierung angelegt ist. Castorp steht eigentlich für einen männlich-sachlichen Charakter, und er wird quasi in dieser Frau zu einem liebenden Mann und ist damit in einem Spannungsfeld, das einerseits Erotik ist, aber auch den Tod bedeutet – so wie Homosexualität lange Zeit codiert wurde.
- Es geht aber nicht nur um Erotik, sondern auch um Liebe, und dass die Liebe eine Krankheit ist, ist schon lange in der Kulturgeschichte präsent. Hier wird dies ganz radikal ausformuliert.
- Es ist eine Krankheit der Zeichen – die Krankheit selbst produziert andauernd körperliche Symptome, die überschüssig sind und damit auf die Zeichenkrise der Moderne verweisen, wo den Signifikanten keine eindeutigen Bedeutungen zugeordnet werden können. Hier sind es die Körper der Patienten, die diese Performances selbst machen. Der Roman steht damit auch in einer Tradition der Zeichenkrise der Moderne.
- Krankheit steht auch für die Ökonomie. Mann selbst hat sich als Kaufmannssohn ausgiebig mit Wirtschaft beschäftigt, in „Buddenbrooks“ und „Königliche Hoheit“. Die Ökonomie des Zauberbergs ist eigentlich eine, die auf Spekulationen und Verschwendung ausgelegt ist und darum in Manns Augen eine schlechte Ökonomie ist. Die Figuren schlemmen und konsumieren unentwegt, produzieren aber selbst nichts außer Zeichen.
- Die Krankheit steht natürlich auch für Rausch und damit für das Dionysische in der klassischen Dichotomie bei Nietzsche, die für Mann auch extrem wichtig war.
- Damit steht sie auch für die Vermischung, die Auflösung klarer Grenzen. Es ist ein großes Durcheinander, die Grenzen zwischen Mensch und Tier werden überschritten, aber aus dieser Vermischung generiert sich auch neue Bedeutung.
- Die Krankheit ist auch eine Störung – eine Störung des Lebensablaufs des jungen Mannes. Auf dieser formalen Ebene gibt es andauernd Störungen, die immer wieder hervortreten, immer wieder etwas unterbrechen und damit aber auch immer wieder einen Raum der Reflexion öffnen. Die sieben Jahre auf dem Zauberberg unterbrechen den klassischen Lebenslauf Castorps, aber sie sind zugleich als eine Reflexion auf die europäische Geistesgeschichte des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts angelegt.
- Mit diesen Störungen wird auch etwas anderes hervorgehoben: die Störung im kommunikationstechnischen Sinn. Dies verweist darauf, dass der Roman andauernd einer ist, der Medien und Medialisierung thematisiert, sei es im sprachlichen, aber zusätzlich auch im ideologischen Sinn. Ganz konkret werden die Medien der Zeit untersucht: das Kino, der Plattenspieler, aber auch die menschlichen Medien, die Geister hervorrufen.
Final lässt sich also sagen: Die Krankheit kann für die Moderne stehen in all ihrer Ambivalenz. Der Roman ist eine Auseinandersetzung mit der Moderne als solcher und der Versuch, noch einmal nach dem Ende fester Sinnzusammenhänge eine Totalität zu erzeugen. Wenn dies durchgespielt wird, alles zusammenzubringen, dann aber scheitert es – es scheitert auf intellektueller Ebene und es scheitert auf realweltlicher Ebene. Der Roman ist damit zugleich eine Abgrenzung von der Moderne und inkorporiert diese.
Das Kapitel „Schnee“ ist das berühmteste des Romans. Hier wird eine Synthese versucht und eine Abkehr vom Tod, die Castorp aber sehr schnell wieder vergisst. Dies ist wie eine Nahtoderfahrung und ein Whiteout beschrieben – eine Vision, in der sich Castorp mit dem Tod in seiner faszinierenden Gestalt auseinandersetzt und behauptet, hinter die Kulissen zu blicken. Dabei erkennt er, dass im Zentrum des Todes nicht schöne Jünglinge in sonnendurchfluteten Landschaften stehen, sondern alte Frauen, die Kinder zerreißen. Damit ist gemeint, dass dem Tod in seiner politischen Gestalt immer ein dionysisch-mythologischer Kern innewohnt, dem Tod in seiner anthropologischen überzeitlichen Gestalt ein abjekter Kern.
Tatsächlich ist in diesem Kapitel „Schnee“ die Auseinandersetzung Castorps mit dem Tod noch nicht zu Ende. Er braucht sie einerseits auf der transzendenten Ebene mit dem Plattenspieler und der Auseinandersetzung mit der Musik, die eine höhere Erfahrungsdimension ermöglicht, und andererseits in immanenter Weise mit dem Krieg, bevor die Vermischung vollends wird und in der großen homoerotischen Fantasie des Weltuntergangs die Welt zugrunde geht.
Der Roman lebt als Gesellschaftsroman natürlich von seinen Figuren, die im begrenzten Raum des Sanatoriums gezeigt werden. Man kann sie in mehrere Gruppen aufteilen:
- Joachim Ziemßen, der beflissene Soldat, der nicht bleiben möchte, aber muss, und Castorps Vetter James Tienappel, der kommt, um ihn zu holen, und schnell Reißaus nimmt.
- Das Paar Karen Karstedt und Klawdia Chauchat, wobei Karen Karstedt quasi für das Störende des Personals steht und Klawdia Chauchat als „heiße Katze“ uns quasi moderne Farben vermittelt.
- Die Ärzte Behrens und Krokowski: der eine jovial und wie ein alter Mann immer kalaubereit, der andere ein intellektuell scharfer Psychoanalytiker, der antisemitisch gezeichnet wird.
- Leo Naphta, ebenfalls antisemitisch gezeichnet, als Vertreter des jesuitischen Gottesstaates und einer Terrorrepublik, dagegen der leichtfüßige Settembrini, der als klassischer Aufklärer sich abgewertet sieht aufgrund seiner Kleidung.
- Zuletzt Mynheer Peeperkorn und Ellen Brand, zwei Medien eigener Art, wobei der eine als große charismatische Intellektuellenfigur alle hinter sich lässt und die andere körperliche Erscheinungen hervorruft bis zu ihrer völligen Verausgabung. Beide illustrieren als Figuren eine gesteigerte Auseinandersetzung mit der Idee von Krankheit und Tod in dieser Zeit.